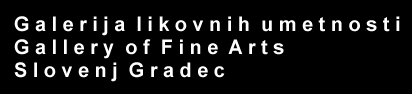
Gerhard Wohlmann
Dynamis
Innen und Außen
Am Anfang war das Wasser, so
könnte die biologische Ursprungsbeschreibung lauten, würde man sie jener
poetischen altestamentarischen Formulierung entleihen, mit der der Schöpfungsmythos
seinen Anfang nimmt.
Im Zentrum des Environments
Aquarium von Darko Lesjak steht das Wasser und auch seine schöpfungsgeschichtliche
Bedeutung.
Bevor aber auf die Bedeutung
des Wassers in Lesjaks Werk eingegangen wird, sollte der Begriff des Environments
näher beleuchtet werden. Auf dem Felde der Kunst hat sich dieser Begriff
für die Bezugnahme eines vornehmlich dreidimensionalen Kunstwerkes auf
seine räumliche Umgebung eingebürgert. Denkt man etwa an die Arbeiten der
Arte Povera-Künstler wie Giovanni Anselmo, Mario Merz oder Jannis Kounellis,
so wird mit deren Wurzeln, die im Futurismus und im Dadaismus liegen, der
dahinterliegende rezeptionsästhetische Gedanke erkennbar. Die Einbeziehung
des Künstlers ins Kunstwerk, die damit verbundene Verwebung von Betrachter
und Bildrealität und die daraus resultierende Verknüpfung von Innen- und
Außenraum sind die theoretischen Grundlagen für Marcel Duchamps Fahrrad-Rad
(und Folgende), womit nicht nur die Funktion des Künstlers in der Gesellschaft
des beginnenden 20. Jahrhunderts und die Aufgabe des Kunstwerkes hinterfragt
werden, sondern bereits eine Antwort zu liefern versucht wird. Die raumübergreifende
Inszenierung (Ausstellungshalle und Öffentlichkeit) soll das Bewußtsein
für einen veränderten Stellenwert von Kunst schärfen.
Darko Lesjaks Aquarium wirkt
zunächst wie ein Ausstellungsraum an dessen Wänden Bilder hängen. Doch
der erste Eindruck täuscht. In Wirklichkeit betritt man einen Raum, der
sich im Kunstwerk befindet. Das was der Betrachter als einzelne Bilder,
die nebeneinander an der Wand hängen, wahrnimmt, sind transparente Fenster,
die jene vom Künstler geschaffene Unterwasserwelt in Ausschnitten zeigt.
Der Rezipient begeht quasi einen Unterwasserraum. Diese Inszenierung ist
jedoch auch wieder nur Illusion, denn nicht die Welt jenseits der Fenster
ist vom Künstler geschaffen, vielmehr sind es die Fenster selbst, die bemahlt
wurden.
Bereits im 19. Jahrhundert
wird das Spiel mit dem Wechsel von Innen und Außen, vom ausgestellten Objekt
in der Vitrine und außerhalb der Vitrine zu einem der Höhepunkte der Weltausstellungen.
Waren vordem Wasserbehälter als Aquarien auf Tischen in Wintergärten ausgestellt,
wird zum ersten Mal 1860 im Bois de Boulogne eine Grotte errichtet, in
deren Inneren sich dem Besucher der Anblick einer Unterwasserwelt eröffnet.
Auf der Weltausstellung von
1867 vermitteln jene begehbaren Aquarien dem Publikum den Eindruck als
befänden sie sich selbst in einem abgeschlossenen Raum unter Wasser und
könnten so das natürliche Leben der Unterwasserwelt verfolgen.
Während im 19. Jahrhundert
noch kein rezeptionstheoretischer oder symbolischer Hintergrund zu diesem
Ausstellungsmodus führte, sondern der Ausstellungsmodus lediglich Ausdruck
einer veränderten Präsentationsästhetik war, ist für Darko Lesjaks Aquarium
der rezeptionstheoretische Ansatz und seine Symbolik eine wesentliche Voraussetzung.
Allerdings wäre es völlig mißverstanden erwartete man eine klar formulierte
Botschaft. Der Sinngehalt der Symbolik bleibt in der Schwebe, weil sie
nicht begrifflich fixierbar werden soll. Das Oszillieren des Betrachterstandpunktes
und damit auch der Realitätsebenen spiegelt jene komplexe Wechselwirkung
zwischen Kunstwerk und Betrachter, deren Wirkung sich in der Form kreativer
Spuren niederschlägt und als solche sollen sie auch wahrgenommen werden.
Durch die sensitive Wahrnehmung gelangt der Rezipient mit dem Künstler
auf die gemeinsame metaphysische Ebene der ursprünglichen Ideen.
Archaische Formen
Das Symbol des Ursprünglichen
findet sich in Lesjaks Werk in zweifacher Hinsicht wieder. Zunächst ist
es die soeben angesprochene Symbolik der ursprünglichen Ideen. Zum anderen
wird der Begriff des Archaischen bildimmanent. Die Objekte die sich vom
blaugrünen Hintergrund des Wassers abheben, scheinen wie übergroße Flagellaten
das Wasser zu durchschweben. Das Wasser als Keimzelle des irdischen organischen
Lebens wird dem Betrachter in seiner Monumentalität vor Augen geführt.
Betritt man den Raum des Aquariums, ist es wie eine Zeitreise zurück zu
den Anfängen des Lebens. Hierin verbirgt sich ein für Darko Lesjak gewichtiges
Thema seiner Kunst, nämlich die Gestaltwerdung biomorpher Körper. Schon
während seiner ersten künstlerischen Ausbildungszeit in Ljubljana wird
er in klassischer Weise an den Körper herangeführt. In den Sälen der Anatomie
interessiert ihn unter anderem das Studium der Evolution des menschlichen
Körpers, von der einfachen Struktur des Embryos bis hin zum Neugeborenen.
Aber auch sezierte Details des erwachsenen menschlichen Körpers, vor allem
des Bewegungsapparates werden zeichnerisch studiert. Gerade der Bewegungsapparat
stellt für das spätere Werk eine wichtige Grundlage dar, denn hier wird
das Thema der Bewegung zum zentralen Punkt. Es darf auch nicht als Sensationslust
oder gar als makabere künstlerische Provokation gewertet werden, wenn Lesjak
sich zeichnerisch und auch photographisch in sezierte Körperteile vertieft.
Erst durch die geradezu wissenschaftliche Distanz zur Grausamkeit und Gegenwart
der Vergänglichkeit des Körpers kann die körperliche Form erfaßt und durchdrungen
werden. Dabei werden die Photographien und auch die Zeichnungen jener Zeit
zu Dokumentationen der Erforschung des Körpers. Sind diese frühen, klassischen
Zeichnungen noch keine autonomen Kunstwerke, sondern als Nebenprodukte
jenes sensitiven Forschens zu werten, so verbirgt sich in den Photographien
bereits eine künstlerische Bedeutung. Nicht einzelne körperliche Strukturen
stehen hier im Mittelpunkt. Vielmehr ist es die museale Situation der ausgestellten
anatomischen Objekte und die damit verbundene gleichsam paradoxale Situation,
die sich im Spannungsfeld zwischen dynamischem Prozeß der Entstehung menschlichen
Lebens und der Konservierung toter Materie entfaltet. Genau diese Situation
spiegelt sich dann im Aquarium wider. Die im Aquarium dargestellten Körper
suggerieren zwar Bewegung, in Wirklichkeit jedoch sind sie statisch, da
sie ja auf die Fenster aufgemalt sind. Der dahinter stehende kunsttheoretische
Ansatz stellt die Bedeutung des Kunstwerkes als dynamisches Kommunikationssystem
zur Diskussion.
Ist der Ausdruck und die Bedeutung
eines Kunstwerkes zeitinhärent oder überzeitlich? Anders gefragt: Erstarrt
ein Kunstwerk nach seiner Enststehung zum konservatorischen Objekt oder
ist es imstande sich der Evolution verändernder Wahrnehmungsaspekte zu
stellen?
Bei genauerer Betrachtung einer
Photographie des Anatomiesaales fällt eine über der Eingangstüre hängende
Uhr ins Auge. Es ist kein Zufall, daß Darko Lesjak die Uhr mit ins Spiel
bringt, ist sie doch unverwechselbares Zeichen der Veränderung, der Bewegung
und des Fortschreitens. Doch die im Photo fixierte Uhr zeigt für immer
die selbe Zeit an. Dahingegen läuft die im Fenster des Aquariums sich spiegelnde
Uhr stets mit. Damit macht Lesjak seinen künstlerischen Anspruch unmißverständlich.
Dynamische Zeichen und gesprengte Rahmen
Der dynamische Prozeß, der sich
in der rezeptionsästhetischen Entwicklung des Kunstwerkes zeigt, wird durch
den Gestus im Pinselstrich Darko Lesjaks zum Ausdruck gebracht.
Während ihn noch als Student
der Münchner Kunstakademie der strenge, geometrische Bildaufbau reizt,
setzt sich bald eine expressive, gestische Darstellungsweise der menschlichen
Figur durch. In seinen Zeichnungen durchpflügen an- und abschwellende Linien
rund und kantig das weiße Papier bis sich Gestalten aus den Verknotungen
und Kreuzungen des Liniengeflechtes herauszulösen beginnen. Die Energie
der zeichnenden Hand wird sicht- und spürbar. Sie wird nicht einer Idee
von zeichnerischer Bestimmtheit unterworfen, vielmehr wird ihr freies Spiel
gelassen um der Spontanität der künstlerischen Arbeit eine autonome Entfaltung
zu gewähren. Deshalb sind Darko Lesjaks Arbeiten Beschreibungen von Bewegungsmomenten.
Selbst scheinbar in Ruhe verharrende Körper werden durch die Dynamik des
Striches ihrer Bewegungslosigkeit entrissen. Nicht das Wesen einer dargestellten
Person, nicht seine Psyche, wie dies bei den expressionistischen Künstlern
im Vordergrund stand, sondern die Essenz körperlicher Dynamik fasziniert
Lesjak.
Damit hat sich der Künstler
aus einer wichtigen forschenden Phase, nämlich der Auseinandersetzung mit
der expressionistischen Tradition, zu einer eigenständigen künstlerischen
Charaktere entwickelt. Der menschliche Körper spielt in seinen Bildern
weiterhin eine zentrale Rolle. Allerdings wird der eingangs beschriebene
Prozeß der Entindividualisierung darüberhinaus fortgesetzt, hin zu einer
Entgegenständlichung, die den Gestus des dynamischen Körpers zu einer eigenwertigen
Struktur werden läßt. Lange Zeit hat Lesjak den Sprung zur entgültigen
Entgegenständlichung gescheut. Seine neuesten Arbeiten führen jedoch die
Realisierung dieses Überganges deutlich vor Augen. Momente der körperlichen
Energie scheinen sich aufzulösen in einer piktographischen Sprache. Doch
ist es weniger eine Auflösung, die sich hier vollzieht , als vielmehr eine
Transformierung in geistige und mentale Energie. In einer geradezu kalligraphischen
Ausdrucksweise überträgt sich die Spannung der mentalen Konstitution des
Künstlers auf den Betrachter.
Während die Arbeiten von 1994,
wie etwa Das Spiegelbild, Frau in Türkis oder Die Turnerin bis hin zu den
bereits deutlich abstrakt gewordenen Bildern von 1998 Die Schnecke oder
Grün trotz des dynamischen Pinselstriches noch eine deutliche Bodenhaftung
der Figuren aufweisen, hält in den neueren Arbeiten wie etwa in der vierteiligen
Langen Nacht die Schwerelosigkeit Einzug. Die im Pinselstrich aufgelösten
Körper werden durch eine gleichsam explodierende Gestik zu auffahrenden,
stürzenden, rasenden Objekten, die den Rahmen des jeweiligen Bildformates
zu sprengen drohen. Der dynamische Prozeß des Malaktes geht hier über die
vorgegeben Grenze des Bildformates und dies ist nur möglich wenn man sich
von dieser Grenze nicht einschüchtern läßt. Auf die mentale Verbindung
zum Energiekonzept asiatischer Kampfkünste macht Darko Lesjak aufmerksam.
Lesjak, der in seiner Jugend selbst mit der Philosophie asiatischer Kampfkünste
in Berührung kam, erfuhr dort wie mit mentaler Energie Grenzen zu überwinden
sind. Um ein Brett mit der bloßen Faust spalten zu können, riet ihm sein
Lehrer nicht das Brett als eigentliche Fläche des Auftreffens zu sehen,
sondern sich diese Fläche etwa fünfzehn Zentimeter dahinter vorzustellen.
Nur dann könne man mit der uneingeschränkten Energie auf das Brett auftreffen.
Ähnlich verhält es sich beim
Malakt. Die Energie des Pinselstriches muß über den vorgegebenen Rahmen
des Formates hinausgedacht werden, nur so ist die Sprengung des Rahmens
überzeugend.
Diaphane Strukturen
Darko Lesjak genügt jedoch die
Überwindung der zweidimensionalen Abgrenzung nicht. Er geht noch weiter
und arbeitet an der Durchbrechung der dreidimensionalen Grenze. Bei seinem
künstlerischen Lehrer Jürgen Reipka ist er mit dem von jenem entwickelten
Monotypieverfahren in Berührung gekommen. Hierbei entdeckte Lesjak die
Möglichkeit der Auflösung eines festen Malgrundes. Mit diesem Verfahren
gelingt es ihm Transparenz zu suggerieren. Aber die Ergebnisse genügen
Lesjak noch längst nicht. Er beginnt auf Glas zu malen und nun öffnet sich
ihm die dritte Dimension.
Die Farbe wird an manchen Stellen
schließlich so hauchdünn aufgetragen, daß nur feine Farblinien sichtbar
werden, während dazwischen die darunterliegende Farbe hindurchleuchtet.
Bei den Monotypien wird die Farbwirkung durch das Auflicht erzielt; bei
der Glasmalerei hingegen wird die Leuchtkraft der Farbe durch die Transparenz
des Malgrundes erzeugt. Jene intensive Leuchtkraft der Farben ist es, die
nun im Wechselspiel mit der dynamischen Gestik seines Pinselduktus das
explosive Element seiner Bilder noch einmal deutlich steigert. Seine Gemälde
erhalten dadurch eine ungeheure Tiefe, jedoch keine raumillusionistische,
sondern eine in der Fläche verbleibende. Die Tiefe der Bilder wird nicht
durch geometrische Perspektivmethoden, oder etwa durch eine raffinierte
Licht-Schattenschilderung, wie sie in der traditionellen Malerei üblich
ist, erreicht, sondern durch die Transparenz und die Vielschichtigkeit
der geschickt übereinandergelegten Farben. Somit entsteht diese ungeheure
Tiefenwirkung nicht auf der Malfläche, sondern durch sie hindurch. Der
in dieser Weise modellierte Lichtraum ist grenzenlos in seiner Tiefe.
Angeregt durch die Arbeiten
mit Glas, unternimmt Darko Lesjak jetzt den Versuch überdies auf der Leinwand
eine derartige Transparenz zu suggerieren. Dabei wird die Leinwand mit
speziellen vom Künstler selbst zusammengestellten Malgründen vorbereitet,
es werden außergewöhnlich reine Farbpigmente mit besonderen Bindemitteln
angerührt, so daß schließlich die Leuchtkraft jener auf Glas aufgetragenen
Farben erreicht wird, mehr noch, von den Bildern selbst scheint sogar ein
Leuchten auszugehen. Die Intensität der Farbe potenziert die Intensität
des Malgestus, womit jene Dynamik erreicht wird, die der Vorstellung von
der Schöpfung des Universums Ausdruck zu verleihen imstande ist.