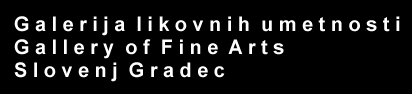
Milena
Zlatar
FONS ET ORIGO
Das Drautal und München
Darko Lesjak, geboren 1966 in
Slovenj Gradec, prägten die Drau und die zufließende Bistrica (Feistritz)
mehr, als er sich dessen selbst bewußt wurde. Seine Jugend verlebte er
in Muta, einem am linken Drauufer gelegenen Ort. In dem Fluss mit träger
Strömung spiegeln sich die Abhänge des Pohorje und des Kozjak und verleihen
ihm eine charakteristische Farbigkeit: vom intensiven Grün bis zu Nuancen
trockener Gräser und farbenprächtigen Herbstlaubs. Der Fremde, der in diese
Gegend kommt, behält deren Erscheinungsbild für immer im Gedächtnis, weshalb
dort die Erinnerungen an den Maler Oskar von Pistor (1865–1928) noch lebendig
sind, einen Maler, der seine Geburtsstadt Wien gegen ein idyllisches, aber
hartes Leben auf dem slowenischen Land eintauschte. Mit dem Maler Pistor
verbindet Darko Lesjak auch die Tatsache, dass beide an der Münchener Akademie
der Bildenden Künste studierten, wohl im zeitlichen Abstand eines ganzen
Jahrhunderts! (Zufälligerweise lernte ich Darko Lesjak eben wegen eines
Gemäldes von Pistor kennen, nachdem ich mich gefragt habe, von wem die
so gute Restaurierung stammt. Lesjak arbeitete nämlich noch als Student
der Pädagogischen Fakultät Maribor im Amt für Denkmalpflege und beschäftigte
sich mit Restaurierungen.) So wie die Liebe Pistor aus Wien und dem kosmopolitischen
München in eine damals entlegene Gegend führte, verschlug die Liebe Lesjak
aus dem Drautal in die Großstadt. Lesjak studierte an der Münchener Akademie
von 1992 bis 1997, als er die Meisterklasse bei Prof. Jürgen Reipka abschloss,
seit 1999 ist er auch dessen Assistent. Den Maler Pistor präsentierte die
Galerie Slovenj Gradec auf einer Ausstellung 1995 und zeigt nun Darko
Lesjak im Frühjahr 2000, acht Jahre danach, als er in den Räumen der Pädagogischen
Fakultät Maribor als deren Absolvent erstmals ausstellte. Obwohl Lesjak
relativ häufig in seine Heimat zurückkehrte und trotz seiner
Verpflichtungen an der Münchener Akademie und einer intensiven Ausstellungstätigkeit
in Deutschland den Kontakt mit dem Heimatort und den Landsleuten nicht
abbrach, stellte er seit 1992 in Slowenien dennoch nicht aus. Ins »grüne
Tal« kehrte er heim, um »geistige Nahrung« zu holen, die Drau und ihr Zufluss
Bistrica, an deren Ufer er Kindheit und stürmische Jugendjahre verlebte,
bezauberten ihn immer wieder. Dann kam eine erschütternde Erfahrung: der
Bau des Staudamms auf der Koralpe, der die Bistrica (welche Ironie – der
Name bedeutet klarer Fluss, Fluss mit schneller Strömung!) in ein drohendes
Bild des Untergangs verwandelte. Das Flussbett ist häufig trocken, das
Wasser bekommt einen üblen Geruch, und über dem Tal droht die Gefahr von
22 Millionen Kubikmeter Wasser. Die Einwohner, hilflos gegenüber der drohenden
Umweltkatastrophe, errichteten die Ökologische Kapelle und weihten sie
dem hl. Franz von Assisi in Fürbitte und Hoffnung. Die Kapelle wurde zu
einem Wallfahrtsort und zu einem Symbol des Bewusstseins, dass die Fehler,
die der Mensch macht, den einen zugute kommen, jedoch den anderen Unglück
bedeuten. Wasser als fons et origo, als Quelle und Beginn, kann auch als
diluvium, als Sintflut, Ende bedeuten. Darko Lesjak fühlt deshalb mit seinen
Mitmenschen, obwohl er weit weg von ihnen lebt. Sein Genius loci ist mit
dem Ort verbunden, wo er geboren wurde, mit der Landschaft, in der er aufwuchs
und feststellte, dass die künstlerische Sensibilität sein Lebenszweck ist.
Er vereinigte Genius loci und Genius saeculi; die örtlichen Besonderheiten,
die er spürte und in sich trug, sprudelten im Geist der Zeit an der Schwelle
des neuen Jahrtausends hervor. Man kann von einem akzentuierten Interesse
an der Natur, am Makro- und Mikrokosmos sprechen, umso mehr, als er sein
Studium an der Münchener Akademie fortsetzte. Gerade diese Akademie spielte
in der europäischen Malerei im ausgehenden 19. Jahrhundert eine wichtige
Rolle und bedeutete frischen Wind auch für die bildende Kunst Sloweniens;
sie beweist ihre Offenheit auch an der Schwelle des neuen Jahrtausends,
ist sich der Universalität der bildnerischen Sprache bewusst und verschließt
sich nicht Einflüssen von außen in einem engen nationalen Rahmen. Ihre
Absolventen aus der ganzen Welt bringen ihre eigene Kultur nach München,
sie gewinnen in der Stadt eine kosmopolitische Haltung, die sie in eine
idiographische übertragen. Die eigene Ausdrucksform eines jeden von ihnen
lässt ein breites Spektrum von Inventionen bis hin zu Multimediaveranstaltungen
zu.
Bildfläche, Farbe und Stofflichkeit
Der Maler überträgt (projiziert)
eine Kette von Gedanken und Emotionen auf der bewussten und unbewussten
Ebene auf einen materiellen Träger, im gegebenen Fall auf eine glatte Bildfläche:
»Das Bild ist aufgrund dieser Begrenzung ein abgeschlossener Gedanke in
einem abgeschlossenen malerischen Raum, eine Bleibe des Geistes im begrenzten
materiellen Raum der gegebenen Malfläche. Und deshalb eine ewige Herausforderung
der Kreativität der Maler« (M. Butina). Der Bildkörper ist in Lesjaks
Beispiel auf den ersten Blick glatt, in gewisser Weise »geschliffen«, damit
sich beim Auftrag der Pigmente die Wirkung von Glätte, Glanz und Transparenz
nicht verliert. Die Fläche des Malgrunds saugt nur so viel Bindemittel
auf, als sich die Farben binden. »Für den Maler ist die Materie nicht nur
ein Vermittler zwischen der Inspiration und deren Ausdruck; die Materie
selbst besitzt ihre eigene Schönheit« (Raol Dufy). Die chromatische Dimension
der Arbeiten von Lesjak ist besonders wichtig: Es handelt sich nicht nur
um ein Register von Farben und Tönen, die Farbwerte sind von sekundärer
Bedeutung. Es geht um eine bewusste Auswahl der Farben, um ein Leuchten,
für das nicht die Überfülle visueller Kommunikationen im großstädtischen
Alltag der Grund ist. Lesjaks Farben ähneln nicht dem nervösen Pulsieren
der Reklameschilder, das »Farbklima« (nach A. Trstenjak) holte er
sich aus dem Drautal. Mit Grün und Rot suchte er eine Komplementierung,
damit deren Verschmelzung in weiße Transparenz übergeht. Wenn man in seine
Farben »eintaucht«, wird man sich bewusst, was der große Dichter mit dem
Satz sagen wollte: »Wäre das Auge nicht sonnenhell, würde es die Sonne
nicht wahrnehmen« (Goethe). Unsere Sinnesorgane und Empfindungen sind nämlich
für die Farbensprache des Malers empfänglich, sie führt uns in eine bekannte
Welt, ob in die Tiefe eines Flusses oder zum Grund eines Kolkes, unsere
Imagination ist umso größer, je mehr sie uns vom Künstler in echter Form
angeboten wird. Alle unsere Sinne werden mobilisiert, um wahrnehmen zu
können, was wir seit jeher kannten. Die Zugehörigkeit zu einer gemeinsamen
Kultur und einer gemeinsamen historischen Erinnerung kommt stärker zum
Ausdruck, als im Hinblick auf die geschaffenen Muster der einzelnen Gesellschaften,
denen wir angehören, zu erwarten wäre.
Lichtbecken
Für Darko Lesjak ist somit das
Wasser eine Quelle der Inspiration; in seiner Jugend saugte er dessen Gewoge
und Wellenbewegung auf, dessen unaufhörliche Veränderung, die Farbspiegelungen
in dessen Transparenz, und später wurde die Erfahrung entscheidend für
seine Ausdrucksform. Transparenz, Lasur und Bewegung wurden zu seinem Gebot,
zur ästhetischen Norm, aufgrund derer auch die Lichtbecken entstanden.
Es handelt sich um Transpositionen oder sogar Verwandlungen der Substanz,
wo das Bild nicht mehr materiell ist, sondern sich im spezifischen Raum
in das Erlebnis des Lichts verwandelt. Die Transparenz, die schon beim
charakteristischen Farbauftrag auftritt, steigert sich, je mehr der Malgrund
das Eindringen des Lichts ermöglicht und dieses als Linse reflektiert.
Die assoziative Vorstellung davon, wie das Licht den Malgrund durchdringt,
wurde so stark, dass sie Lesjak auf spontane Art und Weise spürte und zu
einem tatsächlich transparenten Material griff – zu Folie und Glas. Diese
verwendete er zunächst als Malgrund und nutzte später letzteres zur Steigerung
der Wirkung des Lichtbeckens.
Rhythmus und Bewegung
Das Denken in materiellen Symbolen zu fixieren bedeutet, eine Linie zu ziehen, ein Zeichen zu machen; bildende Kunst und Schrift müssen daher in Verbindung gebracht werden, gemeinsam sind ihre psychischen Impulse. Die ersten Graphismen drückten höchstwahrscheinlich eher Rhythmen als Formen aus, da die »bildende Kunst in ihren Anfängen unmittelbar mit der Sprache verbunden war und im weitesten Sinn viel näher der Schrift als dem Kunstwerk stand: Sie ist eine symbolische Übertragung und nicht eine Kopie der Wirklichkeit« (A. Leroi-Gourhan). Bewegung und Rhythmus sind die Maxime für das bildnerische Schaffen, ihre Bedeutung wurde in den Fünfziger- und frühen Sechzigerjahren entdeckt (das sogenannte Actionpainting betont die Spontaneität der Geste), und später verband sich die gestische Akzentuierung mit charakteristischen individuellen Ausdrucksformen, was auch beim Schaffen von Darko Lesjak besonders hervortritt. In der Zeichnung bewahrte er zwar die expressive Substanz mit erkennbarer Figur, aber auf die Leinwand und den anderen glatten Malgrund (Glas oder spezielle Folie) übertrug er die Bewegung des »nervösen« Pinsels, der »unruhige Räume« schuf, wie sie bereits Emilio Vedova in den Fünfzigerjahren kannte. Er führt wieder das Dripping ein, das typische Herabtröpfeln, wobei sein Körper über dem etwa 30 Zentimeter über dem Boden liegenden Malgrund die »Pose der Aktion« (Actionpainting) einnimmt und sich die Energie über den ganzen Körper auf die Malfläche überträgt. Lesjak gibt die Strömung des Flusses wieder, man versinkt in die Tiefe des Flussbettes und überlässt sich der Turbulenz der zwar ruhigen Strömung, die zugleich ein Wirbeln seiner Energien ist. Die Spuren des Pinsels oder Lappens sind Aufzeichnung, Knotenpunkte organischer, auf Embryos anspielender Formen: Wasser und Fetus als werdendes Leben.
Die Gestaltung der Ausstellung
in der Galerie Slovenj Gradec ist eine Inszenierung der Ausdrucksform des
Künstlers im Sinn einer ganzheitlichen Belebung des Ausstellungsraums.
»Aquarium II« (die »Uraufführung« fand in München in den Räumen der Akademie-Galerie
statt) war zunächst zusammen mit dem Künstler als eine Art Pendant zur
Münchener Ausstellung im Sinn einer Durchleuchtung (Aquarium im dunklen
und Aquarium im weißen Raum) geplant, dann wurde der Entschluss gefasst,
sich der ursprünglichen Ausstellung möglichst anzunähern, so dass die Wirkung
des Aquariums Licht und Dunkel ausnutzt (bühnenmäßige Aufstellung). Hingegen
wird durch die Aufstellung der Bilder auf Glas das Licht und dessen spezifische
Wirkungskraft genutzt, die die Auswahl des Materials selbst verleiht (Lesjak
spezialisierte sich in der Verwendung von Glas in den Werkstätten von Frauenau
in »Floatglasmalerei«). Die Zeichnungen und Fotografien nehmen bei der
Aufstellung, wo die Problematik des Lichts in der Grammatik der bildnerischen
Sprache besonders exponiert ist, einen besonderen, korrespondierenden Platz
ein.